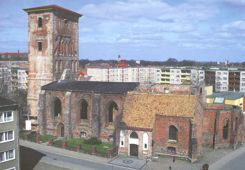Handelte der Beitrag im Mai-Ceryx über die Kampfhandlungen
zur Einnahme Berlins im Frühjahr 1945, soll heute darüber
berichtet werden, wie sich diese auch heute noch im Erscheinungsbild
allerortens bemerkbar machen.
Das Oderbruch, einst der sprichwörtliche Gemüsegarten Berlins,
mußte nach Beendigung des II. Weltkriegs neu urbar gemacht werden.
Die blutgetränkte Erde war überall von tiefen Gräben
und Granateinschlägen durchzogen. Enormer Arbeitseinsatz war
erforderlich, um die bis zu 90 Prozent zerstörten Dörfer
wieder bewohnbar zu machen.
Bei den Älteren ist der Krieg mit seinen unermeßlichen
Zerstörungen natürlich noch immer von großer Bedeutung.
Als Beispiel mag hier die Erzählung eines Golzower Ehepaares
dienen. Der Mann war bereits 1934 in das Oderbruch gekommen, als er
Westpreußen endgültig zu verlassen gezwungen war, da er
die polnische Staatsbürgerschaft nicht annehmen wollte. Die Frau
stammte aus Schlesien und war in den letzten Kriegsmonaten nach Mecklenburg
geflohen. Nach 1945 kam ihre Familie nicht mehr zurück über
die neue Grenze und mußte hier bleiben. Im Oderbruch angekommen,
wollten sie zunächst in einem Haus, das von Granateinschlägen
an mehreren Stellen Löcher aufwies, übernachten. Die Besitzerin
kommentierte dies: „Hier können Sie nicht bleiben. Sie sehen
ja, Hitler hat uns alles beschert, was er uns versprochen hat: Luftige
und sonnige Häuser.“
Noch heute erinnern Munitionsfunde und Unfälle mit Sprengkörpern
an diese furchtbare Zeit. So ist der Krieg in dieser Region noch in
vielerlei Hinsicht gegenwärtig. In kaum einem der Dörfer
hat sich ein Kirchengebäude erhalten. Hier macht es sich bemerkbar,
daß die Kirchen im Oderbruch erst im 18. oder gar 19. Jahrhundert
erbaut wurden. Anders als die mittelalterlichen mit einer Mauerstärke
von bis zu zwei Metern boten sie den Sprengungsversuchen der Wehrmacht
und Kampfhandlungen kaum Widerstand.
|
|
Nun haben viele Kirchen in Deutschland Kriegsschäden
davongetragen. In dieser gewaltigen Dimension aber ist die Lage einmalig.
In manchen Fällen erfolgte nach dem Kriege zwar notdürftiger
Wiederaufbau oder zumindest Restsicherung, vielfach aber blieb die stark
beschädigte Bausubstanz sich selbst überlassen, falls nicht
sogar der Abriß angeordnet wurde.
Nach der Wende kam bei vielen Menschen, nicht nur bei ChristInnen, die
Hoffnung auf, daß entschiedene und schnelle Lösungen gefunden
würden. Tatsächlich aber sind wegen der verschiedensten Gründe
- vor allem aus Geldmangel - bis auf die Beseitigung von Schutt und
Unkraut innerhalb der Mauerreste kaum Fortschritte zu erkennen. Während
in vielen Orten Deutschlands schön anzusehende Kirchen den - nicht
nur sprichwörtlichen - Mittelpunkt des Dorfes bilden, müssen
die meisten Oderbruchdörfer auf ein markantes Gebäude verzichten.
Zerstört sind damit auch Zentren der jeweiligen dörflichen
Identifikation.
Diese mangelnde Identifikationsmöglichkeit ist nicht zu unterschätzen,
denn nach der mittelalterlichen Siedlungsbewegung aus dem Westen des
Römischen Reiches und der Zuwanderung im 18. Jahrhundert hatte
der II. Weltkrieg die dritte fast völlige Bevölkerungsumschichtung
mit sich gebracht. In keiner Region Deutschlands leben so viele ehemalige
Flüchtlinge wie hier. Während viele BewohnerInnen vor den
Kampfhandlungen nach Westen geflohen waren und nur zum Teil zurückkehrten,
blieben viele der Flüchtlinge aus Schlesien gleich hinter der neuen
Grenze in den zerstörten Dörfern hängen. Das Oderbruch
hat keinen eigenen Dialekt, ist aber bei genauerem Hinhören von
schlesischer Mundart durchsetzt.
Als ein Beispiel für die Zerstörungen historischer Bausubstanz
sei hier Golzow genannt. Urkundlich bereits 1308 erstmals als Golsow
erwähnt, erfuhr das Dorf im Zusammenhang mit der Trockenlegung
des Bruchs eine erhebliche Vergrößerung. Der in seiner Struktur
friederizianische Grundriß ist noch heute nachvollziehbar. Den
Ort gliedert ein großer kreisrunder Platz, in dessen Zentrum die
Kirche stand. Sie war ein verputzter Backsteinbau, dessen Kern der Mitte
des 18. Jahrhunderts entstammte. Infolge der Erweiterung von 1854 wurde
das Bauwerk durch Hinzufügen von Anbauten zu einer kreuzförmigen
Anlage mit Turm über der Vierung umgestaltet. Die Golzower Kirche
war als ansehnliches und augenfälliges Gebäude der Mittelpunkt
des Oderbruchdorfes. Im Frühjahr 1945 wurde während der Schlacht
um das Oderbruch die Kirche durch deutsche Truppen gesprengt. Der Abriß
der Reste der Umfassungsmauern erfolgte in den Nachkriegsjahren. Um
die Kirche für immer aus dem Dorfbild zu tilgen, wurde selbst der
Standort unkenntlich gemacht, indem die Straßenkreuzung direkt
darüber geführt wurde. Die Gemeinde richtete im gegenüberliegenden
wiederhergestellten Pfarrhaus einen Kirchsaal ein. In diesem hängt
ein Ölbild, das die ehemalige Kirche als markantes Bauwerk der
Schinkelschule zeigt. Auch die Ruine des einstigen Gutshauses wurde
mitsamt dem Park nach dem II. Weltkrieg abgeräumt. So vermag eine
Golzower Postkarte außer dem vormaligen LPG-Kulturhaus wenig an
markanten Gebäuden abzubilden.
Ein weiteres Dorf aus dem bereits im Mittelalter besiedelten oberen
Bruchgebiet ist Alt-Tucheband, erstmalig 1336 als Tuchbant urkundlich
erwähnt. Auch hier entstand die Kirche erst nach der Trockenlegung.
Sie besaß einen hochaufragenden Turm mit gotisierend-spitzzulaufender
Bekrönung aus dem 19. Jahrhundert. Vor einigen Jahren wurde der
ehemalige Standort von Schutt und Überwachsungen befreit, wobei
leider auch der darunter erhalten gebliebene Fußbodenbelag zerstört
wurde. Die Stelle markieren heute geringe Reste der Turmmauern, in denen
dessen Spitze steht.
Ebenfalls bereits aus dem Mittelalter stammt die Stadt Wriezen am Rande
des mittleren Bruchgebietes. Einst dessen Metropole, nennt sie sich
heute passender „das Tor zum Oderbruch“. Auch hier bietet
sich das typische Ortsbild. Die Stadt ist im II. Weltkrieg fast völlige
zerstört worden, so daß kaum noch ein historisches Gebäude
erhalten geblieben ist. Der unzureichende sozialistische Wiederaufbau
tat sein übriges und so zeigt sich Wriezen heute ziemlich gesichtslos.
Allein im Zentrum wurde nach der Wende versucht, historische Marktplatzsituation
wieder erahnbar zu machen. Das Bild der Marienkirche macht aber deutlich,
daß außer deren Umfassungsmauern von der Altstadt nichts
erhalten geblieben ist. Auch diese einst imposante, dreischiffige gotische
Hallenkirche fiel im Kriege in Trümmer und bietet heute ein trauriges
Bild ihrer einstigen Pracht. In den Resten des südlichen Seitenschiffes
sind unter einem Notdach Kirchsaal und Gemeinderäume eingerichtet.
So fehlt es überall im Oderbruch den Orten an markanter historischer
Bausubstanz, die Identität stiften könnte. Dies wirkt sich
um so nachteiliger aus, als daß eine tiefe geistig-kulturelle
Verwurzelung im Oderbruch auf Grund seiner besonderen Geschichte sowieso
fehlt. Daß die Menschen schon immer traditionslos waren, ließe
sich schließlich auch daran festmachen, daß die Bevölkerung
vor dem Kriege tiefbraun und danach bis zur Wende dunkelrot
war.
bä
|